Was ein gutes Lastenheft enthalten sollte und was Agenturen wirklich erwarten
Jul 30, 2025 — agenturradar.com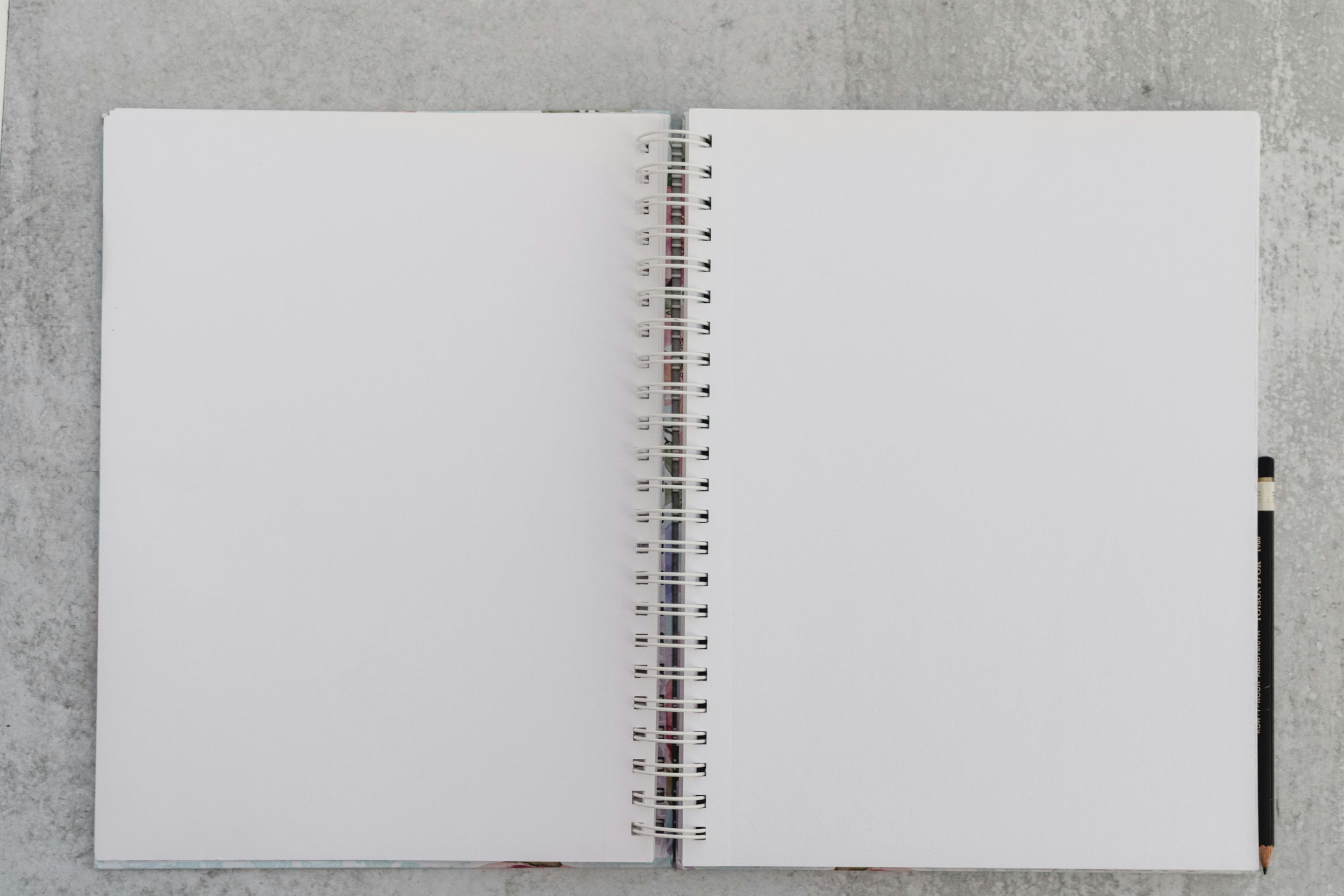
Wenn Ihr ein komplexeres Projekt mit einer Agentur plant – etwa einen Website-Relaunch, eine Softwarelösung oder ein neues CMS – begegnet Euch früher oder später der Begriff Lastenheft. Vor allem bei Ausschreibungen oder wenn mehrere Angebote eingeholt werden, dient es als zentrale Entscheidungsgrundlage. Doch was gehört eigentlich in ein Lastenheft? Wie detailliert muss es sein? Was erwarten Agenturen, wenn sie eines lesen?
In diesem Beitrag erklären wir, wie ein gutes Lastenheft aufgebaut ist, wie es Euch bei der Auswahl hilft und warum es keine 30 Seiten haben muss, um nützlich zu sein.
Was ist ein Lastenheft und was nicht?
Das Lastenheft beschreibt, was Ihr braucht – nicht, wie es technisch umgesetzt werden soll. Es geht also nicht um technische Details oder Lösungen, sondern um Ziele, Anforderungen und Rahmenbedingungen. Im besten Fall schafft das Lastenheft ein gemeinsames Verständnis: Worum geht es im Projekt? Welche Funktionen oder Ergebnisse sollen erreicht werden? Was ist wichtig, und was eher optional?
Dabei ersetzt das Lastenheft kein Gespräch, kein Kennenlernen und keine Konzeptionsphase, aber es sorgt für Struktur, Klarheit und eine faire Vergleichbarkeit von Agenturangeboten.
Wie ein Lastenheft aufgebaut sein sollte
Ein gutes Lastenheft beginnt mit dem Projektkontext. Warum wird das Vorhaben überhaupt gestartet? Geht es um einen Relaunch, einen Systemwechsel oder eine Neuentwicklung? Was ist der Anlass, und was ist bisher vorhanden? Wenn es ein bestehendes System gibt, hilft es, dessen Schwächen oder Grenzen offen zu benennen.
Im nächsten Schritt solltet Ihr die Ziele klar benennen. Was wollt Ihr mit dem Projekt erreichen? Möchtet Ihr Prozesse vereinfachen, Leads generieren, eine bessere Nutzererfahrung bieten? Solche Zielsetzungen helfen Agenturen, Euren Fokus zu verstehen und ihre Vorschläge entsprechend auszurichten.
Anschließend folgt der wichtigste Teil: die Anforderungen. Hier beschreibt Ihr, was das Ergebnis können muss, aber aus Nutzersicht. Statt in technischen Begriffen zu denken, überlegt: Was muss jemand mit der Lösung tun können? Inhalte pflegen? Daten exportieren? Formulare ausfüllen? Besonders hilfreich ist es, typische Anwendungsfälle oder User Stories zu formulieren. So wird nachvollziehbar, wie Ihr das System nutzen wollt und welche Funktionen wirklich wichtig sind.
Ergänzt wird das Ganze durch Rahmenbedingungen: Zeitrahmen, gewünschter Starttermin, grober Budgetrahmen (ja, auch der gehört dazu), technische Vorgaben, Ansprechpartner, Schnittstellen – alles, was für die Planung und das Angebot relevant ist. Wer schon weiß, wie die Zusammenarbeit aussehen soll (z. B. agil oder klassisch, mit wöchentlichen Abstimmungen oder klar definierten Meilensteinen), sollte das ebenfalls benennen.
Auch hilfreich: Klar sagen, was nicht Teil des Projekts ist. Das kann Hosting sein, das Design, die Inhaltspflege – alles, was Agenturen sonst vielleicht mitdenken würden.
Was Agenturen wirklich erwarten
Ein Lastenheft muss nicht perfekt sein. Es darf unvollständig sein, Fragen offenlassen oder in Teilen grob bleiben, solange es nachvollziehbar, ehrlich und strukturiert ist. Agenturen schätzen es, wenn sie den Projektkontext verstehen, die Ziele einordnen können und wissen, was Euch wichtig ist. Sie sehen ein gutes Lastenheft auch als Zeichen dafür, wie Ihr Projekte angeht: realistisch, vorbereitet, entscheidungsfähig.
Ein gutes Lastenheft schafft Orientierung – für beide Seiten
Ihr müsst kein technisches Konzept schreiben und keine Ausschreibung nach Behördenschema formulieren. Aber je klarer Ihr Eure Anforderungen formuliert, desto besser kann eine Agentur einschätzen, was auf sie zukommt – und ob sie die richtige für Euer Vorhaben ist.
Wie kann der Aufbau eines Lastenhefts konkret aussehen?
Damit Ihr direkt loslegen könnt, hier ein Vorschlag für eine einfache, aber praxistaugliche Struktur:
Einleitung & Projektkontext
Was ist der Anlass des Projekts? Welche Systeme oder Prozesse gibt es aktuell?
Ziele des Projekts
Was soll erreicht werden? Geht es um Effizienz, bessere Usability, Leadgenerierung o. Ä.?
Zielgruppen & Nutzerperspektiven
Wer wird mit der Lösung arbeiten? Was sind deren Erwartungen, typische Aufgaben oder Anforderungen?
Funktionale Anforderungen
Was soll die Lösung aus Nutzersicht können? Gern in Form von Anwendungsfällen oder User Stories.
Nicht-funktionale Anforderungen
Gibt es Anforderungen an Sicherheit, Barrierefreiheit, Performance oder Datenschutz?
Rahmenbedingungen
Zeitplan, Budgetrahmen, interne Ressourcen, bestehende Tools oder Schnittstellen.
Abgrenzung des Projektumfangs
Was gehört nicht zum Projekt – z. B. Hosting, Inhalte, bestimmte Module?
Erwartungen an die Zusammenarbeit
Gewünschte Projektmethodik, Kommunikationswege, Entscheidungsprozesse, Ansprechpartner.
Tipp: Haltet das Dokument übersichtlich – lieber klar und kompakt als ausschweifend und unklar. Ein gutes Lastenheft muss nicht lang sein, sondern verständlich.
Ein Lastenheft ist einfach nicht Eure Welt und Ihr habt weder Zeit noch Muße alles zusammenzutragen, dann meldet Euch bei uns. Wir können Euch sicher supporten!